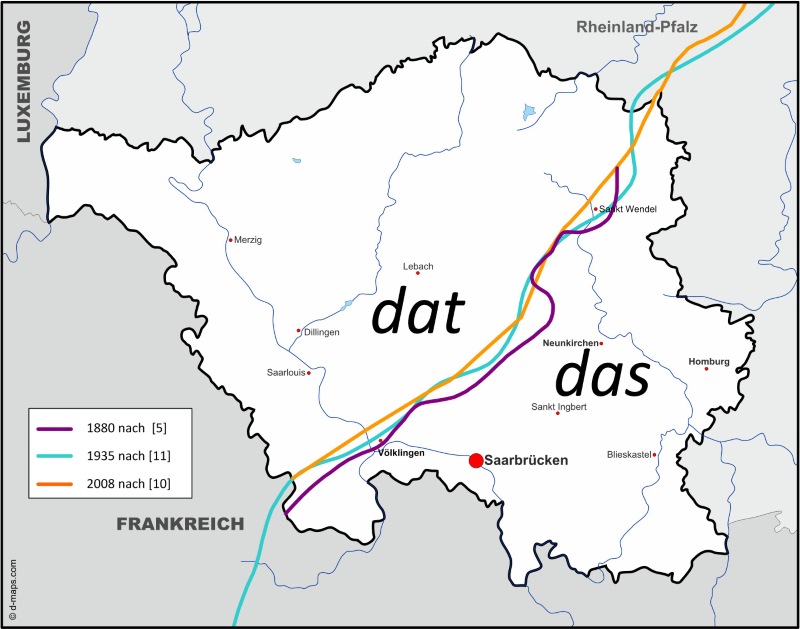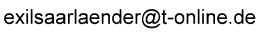Einführung
Saarländisch – das gibt ’s gar nicht! Das Saarland ist nämlich
zweigeteilt – sprachlich jedenfalls!
Im Nord-Westen spricht man moselfränkisch. Ein Dialekt, der in der
Südeifel eher verstanden wird als im südöstlichen Saarland. Dort spricht
man rheinfränkisch, was wiederum mit dem Pfälzischen und dem
(Süd-)Hessischen mehr verwandt ist als mit dem Moselfränkischen.
Früher war die Sprachgrenze sehr scharf. Noch heute spricht man in
Völklingen rheinfränkisch, wenige Kilometer weiter westlich in Bous
moselfränkisch. Die Grenzen verwischen jedoch zunehmend. Außerdem hat über
die Jahrzehnte eine Ausweitung des rheinfränkischen Dialekts in Richtung
Nordwesten stattgefunden, s.a. [5].
Im Allgemeinen wird die Sprachgrenze zwischen dem Rhein- und dem
Moselfränkischen anhand der das-dat-Linie dargestellt:
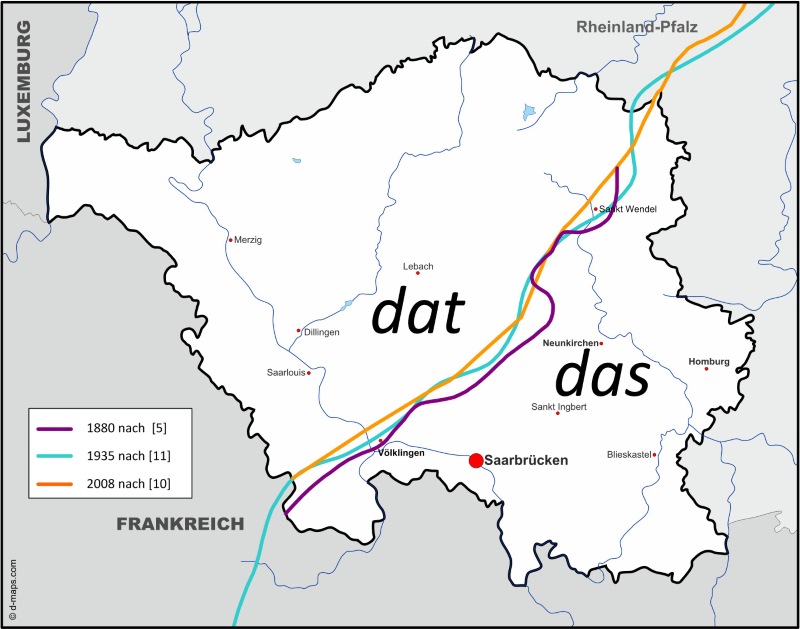
Quelle und Urheberrecht der Basiskarte: D-Maps.com, URL:
https://d-maps.com/carte.php?num_car=6416&lang=de
Weitere Informationen zum „saarländischen" Dialekt:
- hier
im Artikel Mundarten im Saarland von Georg Fox auf den
Internet-Seiten der Tourist-Information Sankt Wendeler Land
- hier
auf Rainer Freyers (✝2021) hervorragenden Saar-Nostalgie-Seiten.
Zusätzlich zur Einordnung rhein-/moselfränkisch gibt es regionale
Unterschiede: In der Kernstadt Saarbrücken heißt es „Schtroßebahn“,
5 km weiter in Dudweiler „Schtroßebohn“. (In Dudweiler kann man
auch "De
Monn mit da long Stong" bewundern – aber das nur nebenbei.)
Zudem sind in Saarbrücken bei bestimmte Wörtern Abweichungen zu
verzeichnen. Südlich eines Bogens von Alt-Saarbrücken bis Gersheim im
Bliesgau wird z.B. aus Lait -> Liit (Leute), aus Wein
-> Winn und aus weiß als Farbbezeichnung ->
wiss. Näheres s. Georg Drendas Kleiner linksrheinischer
Dialektatlas.

Verschiedene Anfragen oder Hinweise deuten darauf hin, dass es Begriffe
gibt, die in einem kleinen Kreis (Familie, Verwandtschaft, Clique)
entstanden sind und nur dort verwendet werden. Ich bitte um Verständnis,
dass dazu keine Auskunft geben kann und solche Wörter nicht in mein
Wörterbuch aufnehme.
Das vorliegende Wörterbuch behandelt überwiegend das rheinfränkische
„Saarbrigger Platt“, so wie es in Saarbrücken gesprochen und oft als
"Oxford-Saarländisch" bezeichnet wird. Bei der Auswahl der Worte
konzentriert sich das Wörterbuch auf typische Begriffe, die meist nicht
einfach abzuleiten sind. Auf eine Übersetzung von „normalen“ Wörtern (wie
z.B. „gudd“ = gut) wird weitgehend verzichtet.
Am Ende des Wörterbuchs sind ein paar Links zu weiteren saarländischen Wörterbüchern
aufgeführt. Dort findet man auch Links zu verschiedenen historischen
Wörterbüchern und Lexika. Wenn man dort nach schlägt, wird man überrascht
sein, wie viele Begriffe nicht nur im Saarländischen, sondern auch in
"verwandten" Sprachräumen vorkommen oder vorkamen.
Für diejenigen, die sich außerhalb des Internets weiterbilden möchten,
gibt es dann noch ein paar Verweise zur gedruckten Literatur
und zu den für dieses Wörterbuch verwendeten Quellen.
Anmerkungen sind durch kursive Schriftart gekennzeichnet.
Kontakt für Anfragen, Hinweise und ernsthafte Kritik (Die E-Mail-Adresse
ist aus Spamschutzgründen als Grafikdatei dargestellt, daher bitte
abtippen):
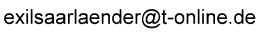
| Wichtiger
Hinweis: Dieses Wörterbuch unterliegt wie alles, was nicht
ausdrücklich als gemeinfrei gekennzeichnet ist, dem Urheberrecht.
Urheberrechtsverletzungen wie Veröffentlichungen auch nur von Teilen
der Inhalte dieses Wörterbuchs werden verfolgt, nötigenfalls mit
anwaltlicher Unterstützung. Das Setzen von Links auf diese Seiten
ist jedoch erlaubt. |
A
abbdrigge
wörtlich: „abdrücken“: hohen Aufwand betreiben oder etwas reichlich
übertreiben mit dem bewussten oder unbewussten Ziel zu prahlen
“Määnsch, driggt der abb!“ (Mensch, der übertreibt’s aber / Mensch, gibt der
aber an, eventuell sogar „wie e Tuud
voll Migge“!)
äbbes
s. ebbes
äbsch
beleidigt, eingeschnappt
ahngeschpuddsd
wörtlich: „angespuckt“ (s.a. schpuddse),
nachlässig befestigt, insbesondere angenäht („Der doh
Knobb waar joh nur ahngeschpuddsd“)
ähs
wörtlich: „es". Im Saarland sind alle weiblichen Personen sächlich, als z.B.
"Es Petra" oder kurz: " 's Petra", s.a. "'s"
allegar
alle ohne Ausnahme, alle zusammen
all(e)gebodd
immerzu, ständig, immer, in jedem Moment; "De Bus kommt allgebodd."
alleh
von französisch "allez!, los, auf geht's oder in Verbindung mit „dann": bis
demnächst
alleh-hopp!
los geht’s, vorwärts! Schlachtruf der Faaseboodse;
vom Französischen „allez!“
allemool
alle Mal (nachdrückliche Bejahung)
als
immer; „De Siggi is als se spääd!“
alsemoh(l)
manchmal, ab und zu: „Mir fahre alsemoh aach an de Middersheimer Weiher.“
Ametz
Ameise
anne
entlang
arisch
arg, sehr: „Ich hann arisch kalt."
Arschgraddser (Arschkratzer)
Hagebutte der Kartoffelrose
Arwett
Arbeit, „Das do is e schwer Arwett."
Äschegruddler
Jemand, der in der Asche (im Müll) wühlt, s.a. gruddele
Äschetonn
Mülltonne („Aschentonne“)
Auleh
Diminutiv (Kose-/Verkleinerungsform) des Eigennamens „August“; meist
abwertend verwendet: „Was iss’n das fier e Auleh!“
aweil oder eweil
jetzt: „Aweil is awwer Schluss!“
B
babbe
kleben („pappen“)
Babbe
Papa
babbisch
klebrig: „Gemmer mohl ens vonn Deine babbisch Guddsjer!“
Babbsagg
abfällige Bezeichnung für einen ungepflegten Menschen
Bach mache
Pipi machen: „Mama, isch muss emohl e Bach mache!“
Baddsch; baddschisch
Schlamm, Matsch - man kann auch „strahle wie e Baddsch-Ähmer“; schlammig,
matschig
Baddschkabb
Mütze, meist flache Schirmmütze: „Hasche schunn moh de Heinz
Begger ohne sei Baddschkabb gesiehn?“
Bagaasch
Bagage (französisch) wörtlich also: Gepäck;
im übertragenen Sinn: Gesindel, Pack
bähre
„bären“: weinen, brüllen
bajaasche
in Eile herum rennen
Ballawer
Palaver, aber auch Lärm, Krach, auch im Sinne von Ärger, Streit.
"Mach nidd so e Ballaver!" Mach nicht so einen Lärm!
"Mid'm Heinds gebbds immer nur Ballaver." Mit Heinz gibt es immer nur Streit
bambele
baumeln
Bambelsupp
Suppe mit Mangold- oder Spinatstreifen, dessen Enden über den Löffelrand
"bambeln" (baumeln); Rezept
Bangerd
Bankert; Schimpfwort: Auf-Der-Bank-Gezeugter
Bäredregg
Lakritz („Bärendreck“)
Bause
Beule, Anschwellung; vgl. Eintrag im Rheinischen Wörterbuch
bawwere
(ver)beulen; s.a. „verbawwerd“
Beddseicher
Löwenzahn; aus dem Französischen: „pisse-en-lit“, s.a. hier,
Punkt 2a
Beggo-Guddsjer
kleine, flache, quadratische Karamelbonbons der französischen Firma „Becco“
(s.a. Guddsje)
beigebläddschd, Beigebläddschder
zugezogen, Zugezogener; vgl. Bläddsch;
vgl. auch Heimatkunde für Saarländer und „Beigeplätschde“
(Sendereihe des Saarländischen Rundfunks);
s.a. Ingeblaggder
bekäbbe; ebbes nidd bekäbbe
wörtlich: "beköpfen": begreifen, kapieren, verstehen; etwas nicht verstehen.
S.a. Rheinisches
Wörterbuch
berabbe
bezahlen (berappen)
Berschmannsguddsjer
graue, quaderförmige Kräuterbonbons (Anis, Fenchel, ...):
„Bergmannnsbonbons“ (s.a. Guddsje)

bibb
müde, erschöpft, abgeschlafft. „Noh'm Schogging bin ich immer so bibb."
Bibbelsche
Schnipselchen; aber auch Küken, Tannenzapfen
Bibbelschesbohnesupp
Suppe aus klein geschnittenen Bohnen
Bibbes
männliches Geschlechtsteil; oft auch in Zusammenhang mit erkältungsbedingtem
Unwohlsein genannt:
"De Kall hat sich de Bibbes verkiehlt."
Bidd
Bütte, Wanne, Schüssel
Bietzjer
kleine Haarzöpfe
bizzele
kribbeln, prickeln
Bläddsch, bläddsche
ursprünglich: flaches Holz zum Schlagen der Wäsche; Klatsche; insbesondere „Miggebläddsch“; auch
Tischttennis-Schläger;
gebläddschd wird auch oft beim Kartenspielen
Blagge
Flecken (Placken)
Blooder (Sing.), Bloodere (Pl.)
Blasen; Meist gebraucht in der Redewendung: "Die Sonn hadd Bloodere
geschien." (Die starke Sonnenstrahlung hat Blasen erzeugt.)
wörtlich: Blas-Pit (Pit =Kurzform von Peter) von Malstatt (Stadtteil von
Saarbrücken);
Unbekannter oder jemand, dessen Namen man nicht nennen will. Antwort z.B.
auf die Frage: „Mit wemm gehd’n ’s Gerdrud seid dem leddschde Sonndach?“
bluddse oder bluzze
hart arbeiten, ranklotzen
Blunds(e)
Blutwurst, aber auch Schimpfwort für eine hässliche Frau
Bobbelsche
(süßes) Baby
Boberd
Käfer, insbesondere Mistboberd
Boll
Schöpfkelle, s.a. hier;
vgl. Sauboll
Bomb
wörtlich: Bombe; Synonym für die Literflasche Bier, die es im Saarland bis
Ende 2002 gab
Boodse
Popel, verhärteter Nasenschleim; aber auch vermummte Gestalt,
s.a. Deutsches
Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm und vgl. Faaseboodse
bossele
basteln, Handarbeiten machen, vom französischen „bosseler“; Substantiv:
Bossler
braddle, Braddler
dünnen Stuhlgang haben, auch im übertragen Sinn; jemand, der (geistigen)
Durchfall hat; s.a. Rheinisches Wörterbuch
Breddulje
Bredouille, Verlegenheit, Bedrängnis, Schwierigkeit
Bremm
Ginster; vgl. „Goldene Bremm“ (Grenzübergang in Saarbrücken zu Frankreich),
s.a. Wörterbuch
der deutsch-lothringischen Mundarten
Brieh
Brühe; oft in der Redewendung verwendet: "Doh kommt die Brieh deirer wie die
Brogge!"
(Da kommt die Brühe teurer als die Brocken - Hinweis auf wenig
kosteneffektives Handeln)
Bruch unn Dalles
Ausdruck für heruntergekommene, ärmliche Verhältnisse, s. Dalles
Bruddsch
Mund mit zum Schmollen verzogenen Lippen bei wenig fröhlicher Grundstimmung;
"Was zieschde heid widder fier e Bruddsch."
bruddschele
brutzeln, kochen (im weitesten Sinn)
bruddse
schmollen; nicht zu verwechseln mit „brundse“!
Bruddsegg
Schmollecke
brundse
pinkeln
Buddigg
boutique, französisch für Laden: hier in der Bedeutung: Haus, Wohnung oder
Zimmer in verwahrlostem, heruntergekommenen Zustand. "Das neie Haus vom
Klaus is e rischdische Buddigg."
Bummerhindsche
meist verwendet in der Redewendung: "Das laaft mir noh wie e
Bummerhindsche", d.h., das (meist Kind) ist so anhänglich wie ein Bummerhündchen
und verfolgt mich auf Schritt und Tritt.
Bummerhund steht für Pommerhund oder Pomeranian (Zwergspitz), eine
Hunderasse, die als besonders anhänglich gilt, s.a. Wörterbuch der elsässischen Mundarten und Rheinisches Wörterbuch
Buwerollser
Mädchen, das sich mit Jungen abgibt, vgl. Rollser
Bux oder Buggs
Hose, „Mach emol die Bux zu, wenn De mit de Leit schwätschd".
C
Cremeschniddsche
wörtlich: Cremeschnittchen; Renault
4CV, französischer Kleinwagen der 1950-er Jahre. Der Name deutet auf die
damals häufig anzutreffende Farbe des Autos hin, s.a. hier
D
Daach X
5. Juli 1959: Tag der (wirtschaftlichen) Rückgliederung des Saarlandes ins
Bundesgebiet; Währungsumstellung Französische Francs in Deutsche Mark, s.a.
hier
Daale oder Daarle
St. Arnual (Stadtteil von Saarbrücken); die Bezeichnung ist ähnlich wie
Dengmert für St. Ingbert eine Verballhornung von Sankt Arnual und hat
entgegen oft geäußerten Meinungen nichts mit Tal zu tun.
dabber oder dabba
schnell, „Mach dabber! Sonschd is de Bus ford." (Laafdabba oder Dabbalaaf:
Durchfall)
Dabbes (Substantiv); dabbisch (Adjektiv)
Tolpatsch; ungeschickt, tolpatschig, tapsig
däderlisch
wenig gewürzt bis geschmacksneutral
Dalles (sich de... holle)
Das Wort Dalles stammt aus dem Hebräischen und steht einerseits für
"zerbrochen", andererseits für "Geldnot, Armut".
Sich den Dalles holen bedeutet sich eine Erkältung zuziehen, s. hier und Eintrag im Duden
s.a. Bruch unn Dalles
Dibbe, Dibbsche
Topf, kleiner Topf
Dibbelabbes
wörtlich "Topf-lappiges":
Kartoffelgericht, eine Art dicker Kartoffelpuffer, eines der vielen
saarländischen Nationalgerichte. Dippelabbes wird im Gegensatz zum Schaales auf dem Herd in der Pfanne bereitet und
nicht im Backofen. Durch das ständige Rühren und Wenden zerfällt die Masse
in einzelne Stücke (Form ähnlich dem Kaiserschmarren). „Mei Mudder hat immer
de Dibbelabbes mit Speck gemacht."
Mit Labbes wird aber auch ein einfältiger, unreifer großwüchsiger
Mensch bezeichnet; vgl. Rheinisches
Wörterbuch
Dirmel
Dummkopf, Tollpatsch; s.a. Wörterbuch der deutsch-lothringischen Mundarten
dirmelisch
schwindlig, verwirrt; "Uff de Bersch- und Talbahn wird merr’s immer so
dirmelisch."
Dochdermann
Schwiegersohn, altsaarländisch. „Em Paul sei Dochdermann hadd sisch e neies
Modorrad kaaf."
doh
da; nachgestellt auch: dieser, diese. "Der Mann doh hadd sei Hudd vergess."
Dieser Mann (da) hat seinen Hut vergessen.
Doofiensche
Verkleinerungsform von (Renault) Dauphine,
in den 1950er/1960er Jahren im Saarland ein weit verbreiteter Pkw,
Nachfolger des Cremeschnittchens
Doofleh
Dummkopf; Gegenteil von Schlauleh
Doole
Wasserabfluss, Kanal-Sinkkasten
Doolewutz
„Schwein“, das sich vornehmlich im Doole
aufhält und deshalb besonders schmutzig ist oder sich besonders schweinisch
verhält
Dreggschibb
"Dreckschippe", Kehrblech
Drieschling
Wiesenchampignon, s.a. Rheinisches
Wörterbuch
Namensgeber für eine Gruppe
von Pilzsachverständigen und Pilzinteressierten aus Kaltnaggisch
driwweliere
tribulieren,
(zur Eile) drängen, treiben
Drohschele
Stachelbeeren
Duddel
Kurbel, "Em Paul sei Audo laaft wie e Duddeldibbsche."
duddele
drehen, kurbeln
dummele
sich beeilen. „Dummel Dich, demidd merr nidd se späd kumme."
duschder
düster, finster
dussma
langsam; französisch: „doucement“.
„Jetz mach emohl dussma!“
Duudsekeppsche
zarte Berührung Stirn an Stirn zwischen zwei sich nahe stehenden Lebewesen,
insbesondere Erwachsener - Kleinkind als spielerischer Beweis der Zuneigung
E
ebbes (auch äbbes)
etwas, „Haschde ebbes scheenes kaaf?"
ei
einleitender Laut, wie "nun" oder "na" im Hochdeutschen zur Betonung oder
zur Darstellung der Selbstverständlichkeit. "Ei joh, nadierdlisch" oder "Ei,
wie gehd's?" (oft auch nur "Ei?")
Eiterklitzje
wörtlich: Eiterklötzchen“, fester Schleimauswurf, s.a. Klitzje
Zum Lösen des Schleims können Berschmannsguddsjer
helfen. Besonders krass ist es, wenn ein Eiterklitzje von der „sibbt Sohl“ stammt.
eniwwer, enuff, enunner
hinüber, hinauf, hinunter
eschdamiere
ästimieren,
vom frz. Verb "estimer": (wert)schätzen i.S.v. würdigen, achten
Beispiel: "Man wird für gute Taten nicht eschdamiert", d.h., man wird
für gute Taten nicht wertgeschätzt oder gute Taten werden nicht gewürdigt
Vielen Dank an Rosi aus Raaschbach (Bliesransbach) für den Hinweis!
eweil
jetzt; s. aweil
F
Faaseboodse
Jemand, der uff die Faasenacht geht und sich „verboodst“
(verkleidet), s.a. Boodse
Faasenacht
Fastnacht; „’s iss Faasenacht, die Kiechelscher
werre gebagg!“
Früher gab es den Brauch, dass Kinder von Haustür zu Haustür gingen und mit
Sprüchen und Liedern um
Süßigkeiten bettelten.
Fäng
Schläge, Prügel
Feez
Spaß, Unsinn; s.a. Rheinisches Wörterbuch des LVR-Institut für
Landeskunde und Regionalgeschichte
Fiedsje
s. Viedsje
Figgediewes
geschickter, cleverer Junge (aus dem Pfälzischen)
Fissääl
Schnur, Bindfaden (vom französischen „ficelle“),
auch besonders dünne Form des französischen Weißbrots
Fixfeier
altsaarländisch für Streichholz, um „fix" Feuer zu machen.
Flabbes
Narr, Depp; (zu) gutmütiger Mensch, der ausgenutzt wird; „Die mache de
Flabbes mid ’m!“
s.a. Rheinisches
Wörterbuch
Fladdschniggel
ungehobelter Mensch ohne Manieren, Tolpatsch, jemand, der leicht in
Fettnäpfchen tritt
Fläggersche
kleines Feuer
Flemm
depressiver Gemütsverfassung, antriebslos, „schlecht drauf" sein";
französisch (umgangssprachlich) „avoir
la flemme": zu faul oder zu träge sein, etwas zu tun
Flitzebohe
selbstgebasteltes Kinderspielzeug zum Bogenschießen
flubbe
rauchen
fohdse
Unsinn/dummes Zeug reden, spinnen
Fohdser oder Fohdsniggel
jemand, der „fohdst“
ford
fort, weg („Geh ford!“: „Kaum zu glauben!“ oder auch „Lass es gut sein!“)
Fregg oder Freck
Erkältung; „Isch hann joh soo die Fregg." Ich bin ja so erkältet.
Freggerd
Lausejunge
Fubbes
Blödsinn, Unsinn: „Mach kä Fubbes!“
Kinkerlitzchen: „Was haschde doh widder fier e Fubbes kaaf!“
aber auch: Wagenschmiere
Gääs
Geiß, Ziege
Gääsegischdere
wörtlich: Ziegengicht; „Doh kennt isch joh die Gääsegischdere krien!“: Da
könnte ich ausflippen/ausrasten!
lt. [2] auch Angst, Furcht, vgl. Gieschdere
Galljer
„Gallier“; Hosenträger. „De Kall hadd Angschd, dass'm ohne Gallje die Bux
runner rudschd."
gammere
starkes Verlangen haben, lechzen, Gimms
auf etwas haben
Gängler
Hausierer
gebluzzd
angestoßen „Denne gebluzzde Abbel maan isch nedd!“
geggisch
verrückt, töricht (entspricht dem „jeck“ im Kölner Raum)
geggisch Ohder
„verrückte Ader“, Nervenstrang am Ellbogen, der bei Stoß Kribbeln auslöst
Geheischnis
(Rückzugs-)Ort, an dem man sich wohl und geborgen fühlt
Gei
Geige, scherzhaft auch für (Elektro-)Gitarre
Geiß
Ziege; andere Aussprache: Gääs
Gellerieb
Gelbe Rübe, Karotte/Möhre
genn (Verb)
wörtlich „geben“, wird im Sinne von „werden“ gebraucht: „De Klään muss noch
gebaad genn“ oder „Das gebbt nix meh!“
Gequellde
Pellkartoffeln
Gespriddsdes
Gespritztes; Bier mit Limonade (Radler, Alsterwasser, Panaché)
Gewwel
Giebel, auch Bezeichnung minderwertigen Tabak, der in Notzeiten am Giebel
wuchs
Gieschdere
Gicht, Zipperlein; lt. [2] auch Angst, Furcht
Gimms
Heißhunger; "Isch hann manschmool so e Gimms uff Schoggolaad."
glunsche
schaukeln, hin- und herwippen, gautschen
Gnägges; auch Kneckes
Knirps, Dreikäsehoch; vgl. Eintrag im Wörterbuch der deutsch-lothringischen Mundarten
Gneschd
Knecht; meist synonym für Junge / Bube verwendet
“Haschd joh reschd, mei Gneschd!“
Good
Patentante, „Mei Good gebbd mer an Neijohr immer e Wiggelgrans."
Graddel
s. Kraddel
grad salääds
"gerade zuleid(s)": jetzt erst recht, zum Trotz
grameddschele, Grameddschler
nörgeln, Nörgler
Grauwurscht
Salami; „graue Wurst“
Gretel im Herbschd
Gretel im Herbst, Ausdruck für unpassend gekleidete Frau (nicht nur weil der
Jahreszeit nicht entsprechend)
grimmelwiedisch
sehr wütend, cholerisch;
bekannt über die Grenzen des Saarlandes hinaus ist die große Dame Elfriede Grimmelwiedisch
Grimmes
(grober) Stock
Grind
Wundschorf
griwwele
kratzen, sich jucken
“Ali, kumm runner ins Café Bagasch! Do huggt
e kläner Nescher unn griwwelt sich am… (weiter von vorne)“
Der Vers wurde als Sprechgesang intoniert. Quelle: Volksmund, 1960er
Jahre. Den Begriff "Neger" bitte im historischen Kontext sehen. Der
Betreiber dieser Internet-Seiten lehnt jede Form von Rassismus und
Diskriminierung ab.
Grub
„Grube", Bergwerk (in NRW: Zeche)
"De Gerd hadd frieher uff de Grub geschafft."
gruddele
stochern, wühlen, etwas stochernd suchen, insbesondere mit einem Schürhaken;
s.a. Äschegruddler
grumbelisch
krumpelig, zernittert
Grummbeer
"Grundbirne",
Kartoffel
Grummbeerkieschelscher
Kartoffelpuffer; nicht zu verwechseln mit Dibbelabbes!
gruschbele
leise, aber nervige Geräusche erzeugen insbesondere durch planloses
Herumkramen z.B. in einer Tasche; Substantiv: Gegruschbel
Grutze (Appel~)
Apfelgrutzen, Kerngehäuse des Apfels
Gruwe-Sengunge
Grubensenkungen (Gelände-Einsenkungen,
verursacht durch den Bergbau)
Guddsje
- Bonbon; Übersetzung von französisch „bon“ ( = gut); s. z.B. Beggo-Guddsjer oder Berschmannsguddsjer
- „Gutzje“, legendäres Ausflugsschiff auf der Saar (Länge: 11 m, 1912
bei Blohm und Voss in Hamburg gebaut, kam Ende April 1960 mit dem Namen
„Gutzje“ versehen nach Saarbrücken, Einsatz als Fahrgastschiff, im März 1964
an die Saarschleife transportiert, dort bis 1980 ebenfalls als
Fahrgastschiff verwendet) Literatur:
[7], [8]

- Adapter ("Puck")
beim Schallplattenspieler, um bei fehlendem Mittelstern Singles auflegen zu
können
- Spitzname für ein früheres Saarbrücker Original:
„'s Guddjse“ lebte in der Zeit nach dem 1. Weltkrieg unter der
Alten Brücke in Saarbrücken und bot seine Dienste (Haarschneiden, Rasieren)
gegen geringes Entgelt an,
s.a. "Ausgabe 0", der Straßenzeitung Guddjze, zum Herunterladen hier (PDF-Datei,
8,4 MB)
- in der Schreibweise Guddzje:
Name einer Saarländischen Straßenzeitung, benannt nach dem vorher erwähnten
Saarbrücker Original
Gummer
Gurke; bei entsprechender Größe auch scherzhaft für Nase
H
Hääde-Bärbel; ~Kind, ~Weib
Hääde steht für Heide im religiösen Sinn, d.h., für
jemanden, der nicht an Gott glaubt und noch bekehrt werden muss. Bärbel
steht stellvertretend für Mädchen oder Frau.
Die Ungläubigkeit wurde mit dem früheren "Zigeunertum" in Verbindung
gebracht. Daher kann sowohl eine ungepflegte, unkonventionell bunt
gekleidete Person (negative Konnotation) als auch ein/e Weltenbummler/in
(eher positive Konnotation) gemeint sein. (Vielen Dank an Andrea
Jost für die Anfrage und die Erläuterungen!)
Haarzbagge
Schimpfwort: jemand, der (Fenner)
Harz an der Backe hat
Haarzkrämer
unseriöser Geschäftsmann
Haarzschmier
eingedickter Rübensaft als Brotaufstrich, bekannt ist das „Fenner
Harz“
Häbsche
Diminutiv (Verkleinerungsform) von Hawe,
meist in der Bedeutung von Nachttopf;
ennem 's Häbsche uffdegge: jemandem die Wahrheit sagen
Halskaul
"Halskuhle"; Genick, „Isch schlahn Dir in die Halskaul." (s.a. Kaul)
hämele oder verhämele
liebkosen, streicheln, verwöhnen, trösten, gut zureden
hämelisch
heimelig; zutraulich
Hardfießer
Hartfüßer; frühere Bezeichnung für Bergleute, die ihren langen Weg zum
Arbeitsplatz zu Fuß zurücklegten
Hawe
Topf, abgeleitet von „Hafen".
„Mei Bruder hadd frieher ganzer Hawe voll Gequellde
gess."
Schimpfwort: Hawebraddler
hemm
heim; „Isch hann die Flemm, isch will
hemm!“
Hewwel
Hebel, Grobian oder auch dicke Scheibe Brot.
„Was haschde doh widder fier e Hewwel vum Brod abgeschnidd!"
Hexenaachd
Walpurgisnacht; Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, in der harmlose,
manchmal aber auch gefährliche Späße von Jugendlichen verübt werden; s.a.
°Immer mehr Straftaten statt harmloser Streiche°, online
bei welt.de
Hibbelheissje
oder Hippelheissje, Variante des Kinder-Hüpfspiels "Himmel und Hölle". Bei
dem Spiel wurden mit Kreide auf dem Asphalt oder mit einem Stock auf der
Erde rechteckige Felder gezeichnet, die in einer bestimmten Reihenfolge erst
auf zwei Beinen und dann auf einem Bein abgesprungen werden mussten. Die
Reihenfolge wurde durch das Platzieren eines Wurfsteins im entsprechenden
Feld bestimmt. Bei einem Wurf außerhalb des gewählten Feldes oder beim
Übertreten der Feldlinien musste der Teilnehmer aussetzen und der Mitspieler
kam an die Reihe. Gewinner war, wer zuerst alle vereinbarten Felder
erfolgreich "durchhüpft" hatte.
Hitt
(Eisen-)Hütte, „De Fons hatt uff de
Burbacher Hitt geschafft.“
holle (Verb)
holen; oft im Sinn von nehmen gebraucht; „De Kall kann esse sovill er will,
er hollt iwwerhaupt net ab“ oder „Er hatt sich’s Läwe geholl“.
Hoorische
Klöße aus rohen Kartoffeln
Hoschbe(l)s(kaschber)
Hospelskasper; jemand, der sich selbst zum Narren macht; Hanswurst; vgl. Pfälzisches
Wörterbuch
hubbse (Verb)
hoppsen, springen
Huddel
Ärger, Schwierigkeiten, "Middem neie Nachbar hann mir nix wie Huddel".
huddselisch, Huddsel(männje)
hutzelig: schrumplig, faltig, runzlig; Hutzel(männchen): abfällig für einen
alten Mann
hugge
hocken, setzen: „Huggen Eich!“ Nehmen Sie doch bitte Platz!
Hundsärsch
wörtlich: Hundsärsche; Mispelschnaps
Hupp
Hinterteil, After, s.a. hier,
Punkt 3". „Ich tapp Dir in die Hupp."
Huwwel, huwwelisch
kleine Erhebung bzw. uneben: „Die Strooß is ganz scheen huwwelich“
I
innewensisch
inwendig, innen, drinnen
Ingeblaggder
Eingeplackter, Zugezogener, Nichteingesessener; jemand, der als "Placken" (Flicken) in eine Gesellschaft eingesetzt
wurde
iwwerzwerch
überdreht, ausgeflippt, übermütig
Wortstamm: zwerch
s.a. Theater Überzwerg,
Saarbrücken
J
jäh
weg. „Am Ausgang hammer ne noch gesiehn, awwer dann warer jäh."
~je
~chen: Endung des Diminutiv (Verkleinerungsform) wie z.B. bei Heisje
(Häuschen), Männje (Männchen), Guddsje,
Klitzje, Schäddsje (Schätzchen), ...;
Die Endung ~sche wird jedoch öfter verwendet wie z.B. bei Dibbsche
Jochnachel
Dummkopf, Sturkopf, ungeschickter Mensch, Quälgeist s.a. hier
Künstlername der Faasenachtsfiguren
Jääb
und Julanda Jochnachel
Johannisbeebsche
Marienkäfer
Jubbe
(Männer-)Jacke, von französisch jupe (Rock). „Häng dei Jubbe doh graad iwwer
de Stuhl."
K
Kabb
Mütze, s.a. Baddschkabb; „Vergess
dei Kabb nidd!“
Sprichwörtlich als Ausdruck der Verwunderung oder Überraschung auch in:
"Legg misch in die Kabb geschiss!"
Käbber(d)
„Köpfer“; Kopfsprung; „De Paul macht sogar e Käpper vom Finfer.“
Kabbes oder Kappes
Weißkohl, oder auch Unsinn. „Schwädds nidd so e Kabbes!"
Kaffeekisch
Kantine einer Grube, s.a. hier
Kaffeestiggsche
Kaffeestückchen; Plunder, „Teilchen“
Kaltnaggisch
wörtlich „kalt-nackend“; mundartlich für Herrensohr (Ortsteil von Dudweiler)
Kannel
(Dach-)Kandel, Dachrinne
Käschde
(Ess-)Kastanien
Kaul
Kuhle, Vertiefung, Grube (s.a. Halskaul,
Lähmkaul, Sandkaul,
Mischdkaul)
kenn meh ... meh
kein mehr, wird in der saarländischen Mundart doppelt verneint. „Ich hann
kenn meh Geld meh."
Kerb, Kerwe
s. Kirb
Kerbelouis, Kerweluis
jemand, der Louis oder sonst wie heißt und die Kirmes
liebt und sich gerne dort aufhält
Kerschdsche
abwertend für ungepflegtes Kind oder für ungepflegte Frau ("Schlampe")
Kerschdscher
Bratkartoffeln aus rohen Kartoffeln in kleinen Würfeln
Kibbe
Kippe; Zigarette; „Haschde mohl e Kibbe fier misch?“
Kiechelscher
„Küchelchen“, Krapfen oder Berliner, vorwiegend zur Faasenacht
Kipp
(illegale) Mülllagerstätte
Kipparsch
Wolf (wundes Gesäß); meist in Verbindung mit der Redewendung "sich einen
Kipparsch laufen" gebraucht;
s.a. hier
Kippsche(r)
Nippel, Brustwarze(n)
Kirb
Kirmes, Jahrmarkt; selten: Periode, Regelblutung
("S' Maria hatt widder die Kirb", s. a. hier,
Punkt 2)
Kleebsche
Pfeife, „'m Edeltraud sei Vadder haschde nie ohne sei Kleebsche gesiehn."
Kligger
Klicker, Murmel; in aufsteigender Wertigkeit aus Ton, Glas oder Stahl
Kligger spielen eine zentrale Rolle im Saarbrücker
Lied
Klitzje oder Kliddsje, ’s Klitzje
stelle
Klötzchen, jemanden ein Bein stellen; „Isch bin nur hingefloh, weil der Saubangerd mir’s Klitzje gestellt hatt.“
kloor
lustig, witzig, interessant, klar;
"Das iss e kloorer Kerl." Aber auch: "Der doh iss nemmeh gans kloor im
Kobb."
Kneckes
s. Gnägges
Kneib
Kneipe, aber auch Kneif oder Kneip (Messer); s.a. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm.
"Grumbeer schäld merr am beschde middem Kneibsche."
Kneschd
s. Gneschd
Kniesje
Endstück vom Brotlaib
Knoddel
Kotballen von Tieren, besonders von Schwein, Pferd, Schaf, Ziege, Hasen
"Isch erschieß' Disch midd 'rer Sauknoddel!" sagte Mariannes Schwiegervater,
wenn er wütend war, zu seinem Sohn.
Koob
Krähe, oft auch als Schimpfwort für ältere Frauen verwendet: "Die ald Koob."
Krachelscher
Croutons
Kraddel
Der Schritt einer Hose, „Die Kraddel von deiner Bux
hängt joh in de Kniekeehl!“
Krahne
Wasserhahn; „Isch hann so Durscht, isch kennd de ganse Krahne leer saufe!“
Krahnewasser (oder auch „Krahneburger“), Leitungswasser
s.a. Wasserkran
Krott
Kröte, „Frieher hann mir am Schlammweiher Krotte gefang."
aber auch scherzhaft auch für kleine Mädchen; aus dem Französischen „petite
crotte“ (wörtlich „kleiner Hundehaufen“; danke für den Hinweis, Jean!)
Krotze
Obst-Kerngehäuse; insbesondere „Abbelkrotze“
krummbelisch
zerknittert; "Isch hann dei Bux erscht gebischeld, jedds isse schunn widder
gans krummbelisch."
krummbuggelisch(e Verwandtschafd)
"krummbuckelig(e Verwandtschaft); Verwandtschaft, die nicht besonders
gelitten wird - oft scherzhaft gemeint
Kutzekopp
Kaulquappe
L
läädisch
überdrüssig, leidig i.S. v. verdrießlich, llustlos, mutlos; auch „de Lääde
hann“
Labbe
Lappen, stand aber auch für den früheren, grauen Führerschein
"De Günder hann'se 3 mool verwidschd, weil er dsu schnell gefahr iss. Jedds
muss er de Labbe abgenn."
läbbsch
läppig,
fad im Geschmack, einfach (zu bewerkstelligen) oder auch schlaff
laddse oder latze
sich genüsslich satt essen, sich laben; s. auch hier
„Beim Christel seinem Geburdsdaach hann mir uns so rischdisch gelatzt."
Laddsegalli
Schipfwort für einen unzuverlässigen Menschen, steht oft auch für einen
Schürzenjäger
Laddserohner
Herumtreiber, Strolch, Taugenichts, scmuddeliger Junge; vermutlich aus dem
Italienischen "lazzarone"
andere Schreibweisen: Laddserooner, Lazzeroner, Latzeroner
Lähmkaul
Lehmgrube (s.a. Kaul)
Lähmscheißer
wörtl.: Lehmscheißer; abschätzige Bezeichnung für Klicker
(Murmeln) aus Ton
Lamäng, aus de
ohne Vorbereitung oder besondere Übung, vom Französischen Artikel „la main".
„Das mach’ isch alles aus de Lamäng."
Läwe
Leben; "Im Läwe nedd!", niemals, nie im Leben!
leck; legg
s. O legg!
lehne
(ver-)leihen; "Kannschde mir mohl dei Moodoorsäh lehne?"
lehre (Verb)
lehren, aber auch oft i.S.v. lernen gebraucht; "Das lehrschde niemeh!"
Lemmes, vom Lemmes gepiggt
vom Schaf(bock) gepickt: verrückt sein, nicht alle Tassen im Schrank haben
lie'e, Liener
lügen, Lügner
linse
hervor- oder hinüberblinzeln, spicken
Lievree, Liefreh
Versteckspiel (Versteggelsches); Lievree schpiele: Verstecken
spielen
"Lievreh!" Ankündigung des Suchenden nach dem Aufsagen eines Spruchs wie
"Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein, ....", dass nun
die Suche beginnt (wie "ich komme!").
S.a. Rheinisches
Wörterbuch
Dazu ein schöner Vers eines
unbekannten Hobbydichters (Dank an Edith für die Übermittlung des
Gedichts!):
Beim Versteggelsches - beim Liefreespiele
erwachten so langsam die Gefiehle
wemma mitme Mäde sich im fremde Hausgang versteggt
hat ma als Bub langsam Neuland entdeckt
un je älter ma wurd war's Liefree beliebter
denn do war ma in der Tuchfühlung schun geübter.
Lumbe
Lappen, von dem mittelhochdeutschen Wort für „Fetzen" abgeleitet. „Hol emol
e Lumbe! Ich hann alles versuddeld."
Lumbekrämer
Altwarenhändler
Lyoner
"der" Lyoner ist die Bezeichnung für saarländische Fleischwurst („Brühwurst
ohne Einlage“), ursprünglich aus Lyon,
seit 2006 europaweit geschütztes Regionalprodukt, s.a. hier
M
Määde
Mädchen
Määderollser
Junge, der sich mit Mädchen abgibt, vgl. Rollser
Mäggesjer
Kapriolen, Spirenzien
Maigibbs
Maikäfer, s.a. Rheinisches
Wörterbuch
maije (gehn)
tratschen, plaudern; zu jemanden gehen, um zu plaudern, zu tratschen, dummes
Zeug zu reden;
s.a. Rheinisches
Wörterbuch oder Deutsches
Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm
Mausohr(salad)
Mausohr-Salat, Feldsalat
Michelsdaach; Schdingke wie de Bogg am Michelsdaach
Michaelistag (29. September, Gedenken an den Erzengel Michael); Stinken wie
der (Ziegen-) Bock am Michaelistag, s.a. Rheinisches Wörterbuch.
Der Überlieferung nach wurden am Michaelistag die Ziegen zum Bock zum Decken
gebracht. Die Ziegenböcke verströmen in dieser Zeit einen strengen, aber für
Ziegen aphrodisierenden „Duft".
Migg
Mücke
Miggebläddsch
Fliegenklatsche (s.a. Bläddsch)
Miggefurz
„Mückenfurz“; Miniböller, meist auf einer Kette aufgereiht mit gemeinsamer
Zündschnur
Mingo, schäler
Spottname für jemanden, der alles übersieht
mir
wir; „Mir sinn Saarbrigger unn schpiele Kligger...“
(⇒ vollständiger Text)
Mischbier
Bier (Helles, Pils) mit Malzbier gemischt
Mischdkaul
Mistgrube (s.a. Kaul)
Molleh (de Molleh mache)
sich (wie ein ungebändigter Zuchtstier) aufführen; „Mach hie nidd de
Molleh!“
(Ein Mollen ist laut Pfälzischem Wöterbuch ein Zuchtstier.)
Moolschd
Malstatt (Ortsteil von Saarbrücken)
N
Naachdesse
"Nachtessen": Abendessen; „Mir hann noch nidd se Naachd gess.“
Nääds
Zwirn, wahrscheinlich von „Nähzeug". „Beim Kades kunnschde frieher all Sorde
von Nääds kaafe."
Naube
Eigenarten, „Er hat äwe sei Naube."
näwenaus
fremd, im Sinne von „fremd gehen". „Wenn de näwenaus geschd, darfschde disch
nidd verwiddsche lasse."
niddemols
nicht einmal; "Noh fünnef Bier kann de Stefan niddemols meh gradaus gehn."
nimmeh oder nemmeh
nicht mehr; vgl. nemmeh dehem - Magazin für die Freunde des Saarlands
von Charly Lehnert
Nischdel
Nestel,
Schnürsenkel
niwwer
hinüber
O
Ochse-Au
"Ochsen-Auge", Spiegelei
Oddschawell
Eau de Javel
(Bleichmittel, früher bei der Jugend beliebt, um die Jeans zu bleichen)
of oder uff
auf, bei
ohrschärisch
armselig, hässlich, kümmerlich; vermutlich vom süddeutschen Wort
„eingeschirrig" (Bauer war so arm, dass er nur ein Tier zum Einspannen
hatte). „Eier Tannebaam is awwer arisch ohrschärisch."
wörtlich: "o leck ..." (der Ausspruch wird nur in Gedanken mit den bekannten
Folgeworten ergänzt); Ausdruck des Erstaunens oder der Überraschung.
"O legg, de Peder! Mit demm hann isch jo gar nedd gereschned!" oder "O legg,
das doh hädd dierfe nedd bassiere!"
Orwes, Orwesse
s. Urwes
P
Padd
Pate, Patenonkel; „De Gerd kriehd von seinem Padd immer scheene Geschengke."
pagge
packen, oft im Sinn von "schaffen". "Das Stigg Kuche doh pagg isch awwer
nemmeh!"
Pänsje (Sg.), Pänsja (pl.)
Verkleinerungsform von Panz: Kind, im (spaßhaft) verächtlichen Sinn,
s.a. Rheinisches
Wörterbuch, Abschnitt 2bδ
petze oder sesammepetze
kneifen, zwicken, zusammen drücken; auch in Verbindung mit dem Auge: "'S Schannett had mier e Petz-Au zugeworf!" (Jeannette
hat mir zugezwinkert!); oft auch: Peetz-Au (lang gesprochener Vokal)
Sprichwort für eine wirkungslose Maßnahme: "Do kannschde aach em Ochs ins
Horn petze."
piddele (Verb)
knaupeln, mit spitzen Fingern an etwas herumarbeiten
Pienzje
überempfindlicher, wehleidiger, mimosenhafter Mensch
Pieps
undefinierte, leichte Krankheit; oft auch abwertend und verhöhnend;
vermutlich herrührend von der Hühnerkrankheit Pips.
Plafong
plafond, französisch für Zimmerdecke
Plümmo
plumeau, französisch für Bettdecke
Pohdsche
sozial und geistig Unterpriviligierter, unsauberer, ungepflegter Mensch,
Schlampe; ursprünglich: Arbeiter, der nur einfache Tätigkeiten verrichten
kann; abgeleitet vom französischen potier (Töpfer, Kesselflicker,
Klempner) [3], [6]
Pondamussong
Pont-à-Mousson (Stadt in Lothringen), wird oft als Bezugsgröße für nicht
weiter bestimmte räumliche Entfernungen herangezogen: „vun hie bis
Pondamussong“
Pööscho
Peugeot, französische Automarke (früher auch die der Polizei-Pkw im
Saarland, s.a. "Polizeifahrzeuge"
auf Rainer Freyers "Saar-Nostalgie"-Internetseiten)
praddle (Verb) oder Praddler
Stuhlgang verrichten bzw. jemand, der seinen Stuhlgang verrichtet
(zu Deutsch: sch.... bzw. Sch...);
oft auch zusammengesetzt: "Dumm-Praddler" (jemand, der geistigen Dünn-Sch...
absondert)
prebele
aufgrund einer negativen Grundstimmung ohne Unterbrechung nörgeln; vgl. brebeln
im Rheinischen
Wörterbuch
Prenggel
Prenkel (Waschbütte)
Puddel
Jauche; oft auch verwendet, um bei anderen einen unqualifizierten Redefluss
abzubrechen:
"Dreh ab, es kommt Puddel!"
Puddsche
Büschel, Bündel, im übertragenen Sinne: kleine Menge
Q
Quer dursch de Gaade
Gemüsesuppe "quer" aus dem Garten, d.h. mit "allem"
R
rabbe
reiben
Rabbeise
Reibeisen
räddsche (Verb)
tratschen, klatschen, (anvertrautes Geheimnis) ausplaudern
rangse
knarren, quietschen, „Die Dier rangst schon widder. Do muschde mohl e Drobbe
Eel draan mache."
raulisch
schlecht, übel; „Oh, mir iss aweil gans raulisch!“ „Das Esse hatt awwer
zimmlisch raulisch geschmeggt.“ vgl. reulich im Pfälzer Wörterbuch.
Reich
alle Bundesländer außerhalb des Saarlandes; Das Deutsche Reich in der Zeit,
als das Saarland selbstständig oder an Frankreich angegliedert war.
Renno
Renault, französische Automarke, s.a. Cremeschniddsche
Ribbschdrang
wörtlich: Rippenstrang; Wirbelsäule, Rückgrat; s.a. Rheinisches Wörterbuch
Riddo
rideau, französisch für Vorhang, Gardine
rischde (Verb)
vorbereiten, anrichten, (mental) einrichten. „Jedds kummt de Pidd doch nedd
zum Esse, isch hann misch awwer egstra gerischd.“
riwwele, Riwwele
rubbeln, „Isch hann geriwweld wie variggd und troddsdem iss de Dregg nidd
abgang."
Als Substantiv für kleine, walzenförmige Teiggebilde z.B. für
Streuselkuchen.
"Viel Riwwelscher Fett, gen e silverni Kett."
Rollser
jemand, der in einem kindlichen Alter, in dem das als verpönt gilt, Umgang
mit dem anderen Geschlecht pflegt, s. Buwerollser
bzw. Määderollser
Rooschdwurschd
Bratwurst (vom Rost)
Rummel
Runkelrübe, vgl. Rheinisches
Wörterbuch
S
’s
das oder es, wird im Saarland als Artikel oder Personalpronomen für alle
weiblichen Personen verwendet, da diese „per Definition“ sächlich sind. " 's
Leonie kummt heid e bissje schpäder."
sääfe
"(ein-)seifen"; jemanden mit Schnee einreiben z.B. im Nahkampf bei einer
Schneeballschlacht
"Wenn isch disch kriehn, dann sääf isch disch!"
Sagg-Arwedd
"Sackarbeit"; Arbeit, die im Beruf für eigene Zwecke (für die eigene Tasche
oder den eigenen "Sack") durchgeführt wird.
Böse Zungen behaupten, es gibt deshalb im Saarland keinen Schwenker im Laden zu kaufen, weil jeder jemanden
kennt, der ihn als "Sackarbeit" herstellt.
Saggduch
Sacktuch, Taschentuch
Salz; im Salz leihe
noch eine Rechnung offen haben; „Der hadd’s bei mir noch im Salz leihe!“
Sandkaul
Sandgrube (s.a. Kaul)
Sässanoh
Cincano (italienischer Wermut); etwas verballhornte französische Aussprache
Sauboll
besonders große Bolle (Schöpfkelle) zum
Verfüttern von Gekochtem an Schweine; s.a. hier
Schaales
großer Kartoffelpuffer im Gegensatz zum Dippelappes
als Auflauf in einem Bräter im Backofen bereitet, eines der vielen
saarländischen Nationalgerichte, vermutlich von „Schale" (- Kruste)
abgeleitet. „Am liebschde ess isch Schaales."
schääl; schääler Mingo
schielend, schief blicken; Schipfwort für hässlichen Menschen
Schaffschuhverschdegg(l)er
Schaffschuh-Verstecker; jemand, der seine Arbeitsschuhe versteckt, um seine
proletarische Erwerbstätigkeit zu verbergen
Schammass
Tand, billiges Zeug
Schdobbe
Stopfen, Stöpsel; Gegenstand zum Verschließen eines Lochs, insbesondere von
Flaschenöffnungen
Scheener
wörtlich: Schöner (Mensch), meist jedoch ironisch gemeint
Scheesewähnsche
„Chaise-Wägelchen", kleiner „Stuhlwagen“ (chaise, französisch für Stuhl):
Kinderwagen oder seifenkistenartiges Gefährt
„Chaise" steht auch für eine kleine, einfache Kutsche mit Klappverdeck.
(sich) schicken
brav sein, sich geziemen, vgl. Duden,
Synonyme zu geziemen; oft als Aufforderung gebraucht: "Schick Disch!",
sei brav, verhalte Dich anständig
Schießdrohd
dünner Draht, der im Bergbau zum Zünden von Sprengladungen ("Schießen")
verwendet wurde
schiffe (Verb)
stark regnen; „Es heerd joh gar nemmeh uff se schiffe.“
pinkeln; „Isch muss mool dringend schiffe.“
Schilleh
Gilet, französisch für „Weste“
Schinoos
wörtlich: Schind-Aas (geschundener Tierkadaver); Schimpfwort für einen
hinterlistigen, durchtriebenen, bösartigen Menschen (überwiegend für Frauen
verwendet) - bei Kindern hatte der Begriff durchaus eine
scherzhaft-liebevolle Bedeutung, vgl. Krott
Schlauleh
Schlaumeier; Gegenteil von Doofleh
Schleuder
Zwille (Katapult zum Verschießen von kleineren Steinen o.ä. mittels
Y-förmiger Halterung und daran angebrachten Gummibändern);
scherzhafte Bezeichnung für ein nicht mehr ganz neues Auto
Schlimmer, Schlimmerbahn
Eisrutschbahn
schlimmere
(zum Spaß) stehend auf Eis gleiten
Schlobb
geflochtene Schleife
Schlohse
Hagelkörner
Schmaddel
schleimige, unappetitliche Substanz
Schmier
„geschmierte" oder belegte Scheibe Brot. „Fier die Middachspaus holl isch
mir immer e Schmier midd."
schmudisch
schmudig: drückend heiß, schwül; s.a. Deutsches
Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm
schnäge (Verb)
naschen, s.a. hier
schnägisch oder schnäkisch
schneubisch, wählerisch, zu anspruchsvoll beim Essen
Schnägsches oder Schnäksches
Süßigkeiten
schnatz
schick, schmuck
Schnerr (uff die Schnerr gehn)
ausgehen (um etwas zu erleben), bummeln gehen
schnerre losse
abschnellen, etwas Vorgespanntes loslassen
Schniss
Mund
Schnurres oder Schnorres
Schnurrbart, Oberlippenbart
schoggele
schütteln, wackeln, schaukeln: „Uff derer Strooß wird ma ganz schee’
durschgeschoggelt!“
Schorschde; Schorschdefeescher
Schornstein; Schornsteinfeger, Kaminkehrer
Schpeis
Mörtel
schpiense (Verb)
wenig essen, im Essen herum stochern
Schpiddskligger
spitzfindindiger, überschlauer Mensch; vgl. Kligger
Schpreeb
Starenvogel
schpuddse
spucken, s.a. ahngeschpuddsd
schroo
unansehnlich, unangenehm. „Der neije Lehrer is rischdisch schroo."
Schtambes
gestampfte Kartoffeln, Kartoffelbrei
Schtegge
Stecken, Stock
Schtigg
(Grund-)Stück, meist zum Obst- und Gemüseanbau zur Selbstversorgung genutzt
schtragg
steif, unbeweglich; auch im übertragenen Sinn: „De Gerd is ze schtragg, um
mool die Kaffeemaschien sauwer se mache.“
betrunken: „Bei der leddschde Kirb ware
mir allegar schtragg."
Schtragger
Kopfsprung: „De Klaus machd e Schtragger vom Finfer“;
aber auch: männliches Liebes- und Fortpflanzungsorgan in einem bestimmten
Zustand
Schtrolle
Stoffwechselendprodukt in Würstchenform, nicht nur vom Hund
schtruddelisch
nachlässig, flüchtig
Schtruddelischkeitsfähler
Flüchtigkeitsfehler
schtruwwelisch
struppig (Haare) „Vom ville Wind sinn mei Hoor gans schtruwwelisch genn."
Schüdds
(Feld-)Schütz, Feldhüter
schwaade
verprügeln, vermutlich von „Schwarte". „Wenn das noch eenmool saschd,
gebbschde geschwaad."
schwäddse
schwätzen, reden, „Bei uns dehemm wird nur Pladd geschwäddsd."
schwaduddle; Schwaduddler
dummes Zeug daher reden, schwätzen; Schwätzer
Schwenkbroode
Schwenkbraten, saarländisches Nationalgericht
Schwenkbidd
Schwenkbütte, Becken in Kneipen zum
Reinigen von Gläsern, vgl. Eintrag im Pfälzisches Wörterbuch
Schwengker
Schwenkgrill für die Zubereitung z.B. eines Schwenkbraten oder Person, die
den Schwenkgrill bedient
"Gott lengkd, de Saarlänner schwengkd." Weiteres hier.
sellemohls
damals, früher, seinerzeit
Sießschmier
„süße Schmiere", Marmelade „'s Maagidd essd am liebschde
Schlehe-Sießschmier."
Simp(e)le
Haare, die ins Gesicht fallen; „Pony“
so
umsonst, saarländische Währungseinheit. „Kenne mir das so kriehn odder misse
mir ebbes defier bezahle?"
Sohl
Sohle, unterirdische „Etage“ (Stollen) in einer „Grub“
Sohnsfraa
Schwiegertochter, altsaarländisch. „Em Renaade sei Sohnsfraa wohnd jeddds im
Reich."
suddele
s. versuddele
T
tappe (Verb)
gehen, laufen, treten; „Dem Gottleh geheert mohl kräffdisch in de Hinnere
getappt!“
täppere (Verb)
auf der Stelle treten; Verhaltensweise insbesondere von Kindern, um z.B.
etwas durchzusetzen; "Du kannschd so lang täppere wie du willschd, Du
krischd keh Eis!"
Tilltappes
Schussel, ungeschickter Mensch
tirengele
drängen, antreiben, nerven
Tohbadd
wie Tilltappes: Schussel,
ungeschickter Mensch
Trauwele
(Wein-)Trauben
triwweliere
s. driwweliere
Troddwa
trottoir,
französisch für Bürgersteig
Troddwa-Schwälbsche
Bordstein-Schwalbe, Prostituierte
Trulla (uff Trulla gehn)
Trulla bedeutet soviel wie Schlampe, s.z.B. hier;
in Verbindung "auf Trulla gehen" im übertragenen Sinn soviel wie ausgehen,
auf eine Party o.ä. gehen
tungke
„tunken", etwas oder jemanden eintauchen. "De Oba muss sei Brood tungke,
weil sei Gebiss kabudd iss."
runterhauen, Ohrfeige verabreichen. "Du krischd glei ähnie getungkt."
Tuud
Tüte; oft in Zusammenhang gebraucht: Vorwiddstuud
oder „Der gebb joh ahn wie e Tuud voll Migge!
U
uff
s.a. „of“; auf, bei
uffstiwwele
„aufstiften“, anstiften, aufwiegeln, aufhetzen
Unn?
Und (wie geht's)? Auf das erste Wort verkürzte Begrüßungsformel; Oft mit
"unn selbschd?" beantwortet.
unnere
(meistens in inoffizieller) Untermiete wohnen. „Er unnert beim Karin."
UrPils
feinherbes Pils-Bier der größten Saarländischen Brauerei
Urwes oder Orwes
Essensrest auf dem Teller, „Bei der Schwiermudder muschede immer alles
uffesse unn derfschd keh Urwese mache."
Uwraasch
Durcheinander, Aufsehen, unnötige Arbeit; vom franzöischen ouvrage (Werk, Arbeit)
V
Vaddersches unn Muddersches
Kinderspiel Vater und Mutter
verbawwerd
verbeult; vgl. bawwerre „’m Fons sei
Audo is ganz scheen verbawwerd.“
verboodse
sich insbesondere an der Faasenacht
verkleiden; von Boodse; "Duhschde Disch dies Johr gar
nedd verboodse?"
verdrillerd
(in sich) verdreht, insbesondere bei Fäden, Garnen, Seilen u.ä., so dass
diese kaum noch zu entwirren sind
vergliggere
„verklickern“, erklären
vergraddele
sich heftig bemühen, eine Arbeit zu erledigen, dabei aber durch hektisches
Vorgehen ineffektiv bleiben
verhämele
s. hämele
verkassemaduggele
hinters Licht führen, verprügeln. „Ich glaab, de Gängler wollt uns
verkassemaduggele."
verknuuse
jemanden leiden können; meist in der negierten Form: "isch kann 's
Elsbett ned verknuuse"; s.a. Rheinisches Wörterbuch
verkrumbele
zerknittern, zerknäulen; „Dei Bux iss awwer verkrumbelt!"
vernebbe
verneppen, täuschen, „Vernebb Dich do mol nidd!“
versuddele
verschütten, „De Kleen hadd widder alles versuddelt.“
verwiddsche
erwischen
Vieds
Vietz, Apfelwein
Viedsje
Beule, insbesondere am Kopf; "De Gisberd hadd sisch de Kobb gestoos und hadd
jedds e gans scheeenes Viedsje."
Vorwiddstuud
wörtlich: Vorwitztüte (s.a. Tuud),
vorwitziger, neugieriger Mensch
W
Wackes oder Wagges
Wackerstein
oder Wacke;
Nichtsnutz, Herumtreiber, Strolch; abwertend für Elsässer und Lothringer im
Allgemeinen, s. z.B. hier
Wälljerholz
Nudelholz
Wedderhex
wörtlich: Wetterhexe; kratzbürstige Frau
Wegg
Weck, Brötchen
widder
wider, gegen; „De Kall hat die Kurv nidd kridd und is dann widder de Baam
gefahr.“
Wiggelgrans
Wickelkranz (eine Art Hefekuchen)
Wippsche
Spaßeinlage, Ulkerei
Wirdschafd
Gastwirtschaft
wurgse
würgen „Mei Vadder hadd sich beim Esse verschluggd unn mussd dann arisch
wurgse."
wurres
wirr, verwirrt, durcheinander
wuschd
hässlich, wüst, widerwärtig; s.a. Rheinisches Wörterbuch
Der Spiesener Karnevalist Klaus Reichard hat den Begriff zu seinem
Künstlernamen De Wuschd gemacht
X
Xangsverein
Gesangverein, sonschd hammer doh niggs!
Y
Yesses, do hammer ah niggs!
Z
Zabbe
Schluss, Ende, von Zapfenstreich, „Als misch de Herberd dann ah noch e Doofleh genannd hadd, doh war awwer dann Zabbe".
auch "zabbeduschder"; Zores, Ärger,
Stunk, Schwierigkeiten
Zeeb
Zehe
Sprüche und Geschichten
über saarländische Essgewohnheiten:
- Erscht mohl gudd gess, (nix) geschafft hann mir dann schnell!
- Mir esse, was annere niddemols
ausschwäddse kinne!
- Der Mensch denkt, Gott lenkt, der Saarländer schwenkt!
- Woraus besteht ein typisch Saarländischer Adventskranz?
Aus einem Ringel Lyoner und vier
Flaschen Maggi (oder 4 Flaschen UrPils)
- Die Pladd buddse: alles aufessen
- Schon Otto (Waalkes) sagte:
"Es geht nichts über geschwenkten Dibbelabbes
und ein frisch gezapftes Glas Lyoner."
über (saarländische) Eigenheiten und andere Redewendungen:
- Besser mer hadd ebbes, was ma
nidd brauchd, als mer brauch ebbes, was mer nidd hadd!
- Köllerdahler Plattfies und Pariser (Schigg-)Schiehscher!
(Der Spruch funktioniert natürlich auch mit jedem anderen saarländischen
Ort.)
- Wenn Frangkreisch nidd wär, läg’s Saaland am Meer.
- Von hinne Lyzeum, von vohre Museum!
- Besser als in die Bux geschiss!
(häufiger Kommentar zu wenig positiven Ereignissen oder Zuständen, wenn
es noch schlimmer hätte kommen können)
- Der iss fresch wie de Dregg im Wäsch
- All zevill verreißt de Sagg.
- Der halld sisch joo draan wie de Narr am Käs.
- Das iss gehubbst wie geschprung.
- Doh kommt die Brieh deirer wie die Brogge!
- In 'rer ald Kapell kann mer aach noch e Mess läse.
Die (Vor-)Weihnachtsgeschichte von Günther Hussong, saarländischer
Mundart-Dichter, -Kabarettist, -Kolumnist, ...
In der Saarbrücker Zeitung zum 4. Advent 2021 stand in der Mundart-Kolumne
die fiktive, aber realitätsnahe Beschreibung, wie sich die
(Vor-)Weihnachtszeit in den letzten Jahren verändert hat.
Diese lesenswerte, da äußerst amüsante Geschichte in rheinfränkischer
Mundart kann man hier nachlesen: Link zu PDF-Datei.
Bei Bedarf kann ich auf Anforderung gerne eine "Übersetzung" ins
Hochdeutsche nachliefern.
Günther Hussong sei herzlich gedankt für die freundliche Genehmigung der
Veröffentlichung der Geschichte auf diesen Internet-Seiten!
Das Saarbrigger-Lied
(„Stadt-Hymne“)
Mir sinn Saarbrigger
unn spiele
Kligger,
mir stemme Bludwurschd midd ähner Hand!
Dass mir Saarbrigger sinn,
das siehd doch jedes Kind,
mir reiße Bähm aus, wo gar kenn sinn.
Die A-capella-Live-Version aus dem Jahr 1984, vorgetragen vom Saarbrücker
Spontan-Chor „Oskar unn die
Pänsja"
kann man sich
hier
anhören und ansehen.
Faasenachtssprüche
und -lieder
Früher wurde an Fastnacht "gesungen". Die Kinder gingen - meist in
Gruppen - von Haus zu Haus, klingelten und sagten ihre Sprüche auf oder
sangen so gut sie konnten. Ähnlich wie heutzutage an Halloween gab es
zur Belohnung Süßigkeiten oder sogar etwas Münzgeld.
Bin e armer Keenich
gebb mer ned ze wenich!
Lass mich ned so lange stehn,
denn ich muss noch weitergehn!
*******************************
’S iss Faasenacht, 's iss Faasenacht!
Die Kiechelscher werre gebagg!
Unn wenn mei Mudder kee Kieschelscher baggt,
dann peife mir uff die Faasenacht!
und eventuell ergänzt durch:
Eraus demidd, eraus demidd,
mir schdegge se in de Sagg!
(Dank an Klaus Latz für den Hinweis auf die 2. Strophe, weitere
Referenz und Varianten: Die Faasenaachd-Seite auf saar-nostalgie.de)
andere
Wörterbücher und Infos im Internet
Literatur und Quellen
[1] Lehnert, Charly u. Bungert, Gerhard: So schwätze mir.
Lehnert Verlag, Saarbrücken. ISBN 978-3-926320-09-4
[2] Braun, Edith u. Mangold, Max: Saarbrücker Wörterbuch. 2. Auflage,
SDV Saarbrücker Druckerei und Verlag GmbH, Saarbrücken 1984. ISBN
3-921646-70-7
[3] Frank, Josef: Saarbrücker Mundart und die Bedeutung des
Ortsnamen Saarbrücken. Gedruckt 1969 Hilger Sulzbach
[4] Kuntze, Erich: Studien zur Mundart der Stadt Saarbrücken
(Lautlehre). Heft XXXI der Deutschen Dialektgeographie, herausgegeben von
Wrede, Ferdinand, 1932. N.G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung (G. Braun),
Marburg.
[5] Ramge, Hans: Dialektwandel im mittleren Saartal.
Veröffentlichung des Instituts für Landeskunde im Saarland, Band 30, 1982,
ISBN: 3-923877-30-7
[6] Bungert, Gerhard: Saarländisch - So schwätze unn so schreiwe mir.
Geistkirch-Verlag, Saarbrücken, ISBN 978-3-946036-51-7
[7] Heinz, Uta: Ein Schiffchen wird ausgebootet. In: Saarbrücker
Zeitung vom 21. Juli 1981, S. 10
[8] Das „Gutzje“ zieht an die Saarschleife. In: Saarbrücker Zeitung
vom 16. März 1964
[9] Schön, Friedrich: Mundart des Saarbrücker Landes nebst einer
Grammatik der Mundart. In: Mitteilungen des Historischen Vereins der
Saargegend, Heft 15, Selbstverlag des Vereins, Saarbrücken 1922
[10] Drenda, Georg: Kleiner linksrheinischer Dialektatlas : Sprache in
Rheinland-Pfalz und im Saarland, Steiner-Verlag Stuttgart, 2008, ISBN
978-3-515-09115-2
[11] Ammann, Hektor (Begr.), Quasten, Heinz (Hrsg.): Geschichtlicher Atlas
für das Land an der Saar. Institut für Landeskunde im Saarland, 1991,
ISBN 978-3-923877-80-5